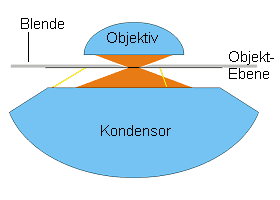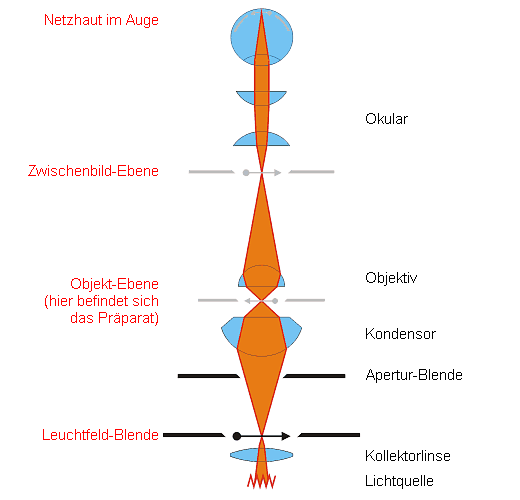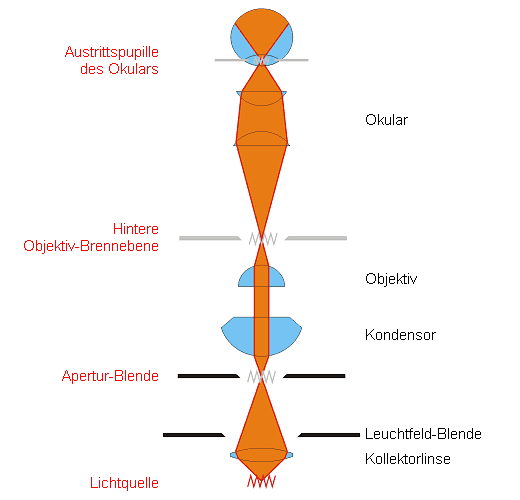Theoretische Grundlagen der Köhlerschen Beleuchtung
AusgangsproblematikArbeitet man mit einem Objektiv 100X und einem Okular mit der Sehfeldzahl 20, so hat der überblickte Ausschnitt im Präparat einen Durchmesser von lediglich 0,2 mm (Sehfeldzahl von 20 mm geteilt durch 100). Neben dem von diesem kleinen Präparatausschnitt kommenden, für die Bildentstehung wichtigen Licht, gelangt jedoch auch noch so genanntes Falschlicht in das Objektiv und stört im weiteren Verlauf die Bildentstehung durch eine Verminderung des Kontrasts. Derartiges Falschlicht entsteht beispielsweise durch Streuung des Mikroskopierlichts an außerhalb des Gesichtsfeldes gelegenen Strukturen des Präparates. Daneben kommt es im optischen System des Mikroskops zusätzlich zu Reflexionen. Hierbei gelangt an Glasflächen reflektiertes Licht ebenfalls in den Bereich der Zwischenbildebenen und sorgt dort für eine Minderung des Kontrasts. Um diese Effekte auszuschließen müsste man nun dafür sorgen, dass nur jener Bereich im Präparat beleuchtet wird, welcher gerade untersucht wird. Bei dem obigen Beispiel wäre dies ein ausgeleuchteter Kreis von 0,2 mm im Durchmesser. Es wäre theoretisch möglich, im mikroskopischen Präparat eine Blende unterzubringen, die entstehendes Falschlicht ausblendet. Dies ist jedoch praktisch nicht durchführbar, da sich die Blende direkt im Präparat befinden müsste und zudem die Herstellung und Handhabung derartig kleiner Blenden sehr schwierig wäre.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||