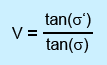|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die relative Größe mit der wir die Dinge sehen hängt davon ab, wie groß deren Bild auf der Netzhaut des Auges erscheint. Um dieses Netzhautbild zu vergrößern kann man das betrachtete Objekt möglichst nahe an das Auge bringen. Hierbei verändert sich durch den Prozess der Akkommodation die Brennweite des Auges und das Objekt wird bei jeder Entfernung scharf gesehen. Die Akkommodation ist natürlich nicht unbegrenzt möglich und nur bis zu einem bestimmten Punkt der Annäherung (=Nahpunkt) möglich. Die Regelung der Akkommodation erfolgt normalerweise ohne bewusste Steuerung über den Kontraktionszustand des Ziliarmuskels, der wie ein Ring in einigem Abstand um die Linse liegt. Die Augenlinse selbst ist elastisch und hat von Natur aus eine eher "kugelförmige" Gestalt. Der normale Innendruck des Auges drückt allerdings den Aufhängerahmen der Linse (im Bild unten oliv und rot) auseinander, wobei auch die Linse quasi auseinander gezogen wird. In diesem Zustand ist sie relativ flach und fokussiert in die Ferne. Der Ziliarmuskel (rot) ist hierbei jedoch entspannt! Beim Betrachten eines nahen Gegenstandes zieht sich der ringförmige Ziliarmuskel zusammen und wirkt somit gegen die Expansionsrichtung des Augeninnendrucks. Der Zug auf die Linse nimmt ab, sie nimmt von sich aus einen eher "kugelförmigen" Zustand an. Der Blick in die Ferne ist auf die Dauer jedoch wesentlich weniger anstrengend als das Betrachten eines Gegenstandes am Nahpunkt des Auges, weil der Ziliarmuskels in diesem Zustand weniger kontrahiert ist, sich also weniger anstrengen muss.
Die Entfernung des Nahpunktes vom Auge ist individuell verschieden. Man arbeitet deshalb mit der Festlegung, dass er bei einem "durchschnittlichen" Auge 250mm beträgt und bezeichnet diese Distanz als "Bezugssehweite" oder auch "konventionelle Sehweite". Die Bezugssehweite dient als Bezugsgröße zur Berechnung der Vergrößerung optischer Instrumente beim visuellen Gebrauch. Ein vergrößerndes optisches Gerät ermöglicht somit die Betrachtung eines Objekts unter einem Sehwinkel, der größer ist, als dies bei einer Betrachtung des gleichen Objekts aus einer Distanz von 250mm der Fall wäre. Wenn Sie sich die obige Darstellung zum Sehwinkel anschauen stellen Sie fest, dass das Netzhautbild mit zunehmendem Sehwinkel wächst. Man erkennt leicht, dass bei einer Verdoppelung des Tangens des Sehwinkels auch das Netzhautbild doppelt so groß sein muss. Die Vergrößerung V eines visuell verwendeten optischen Hilfsmittels berechnet sich somit aus dem Quotienten:
tan(s'):Tangens des Sehwinkels mit optischem Hilfsmittel
Die einfachste Möglichkeit Dinge unter einem vergrößerten Sehwinkel zu betrachten stellt der Gebrauch einer Lupe dar. Nachfolgend soll gezeigt werden, wie der Sehwinkel beim Gebrauch einer Lupe vergrößert wird. Lupen sind von ihrem Prinzip her einfache Sammellinsen. Bringt man ein Objekt zwischen die vordere Brennebene einer Sammellinse und die Linse selbst, so sind die von einem Objektpunkt ausgehenden Strahlen hinter der Linse weiterhin divergent. Unter diesen Umständen entsteht somit auch bei einer Sammellinse kein reelles Bild. Vielmehr kommt es, wie wir es bereits von der Zerstreuungslinse kennen, zur Entstehung eines virtuellen Bildes.
Nun soll die Vergrößerung durch eine als Lupe wirkende Sammellinse bestimmt werden. Hierzu wird in der folgenden Darstellung das Auge an den Ort des Bildbrennpunktes F' der Lupe gebracht..
Eine Lupe mit der Vergrößerung 10x hat demnach eine Brennweite von 250mm/10 = 25mm. Wenn Sie sich die obige Darstellung genauer anschauen werden Sie bemerken, dass die Vergrößerung auch vom Abstand zwischen dem Auge und der Lupe abhängt. Dies trifft allerdings dann nicht zu, wenn sich der betrachtete Gegenstand genau in der vorderen Brennebene der Lupe befindet. Dann beträgt die Lupenvergrößerung immer wie hier dargestellt 250/f. Dies ist auch der Wert, der prinzipiell für die Vergrößerung einer Lupe angegeben wird.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||